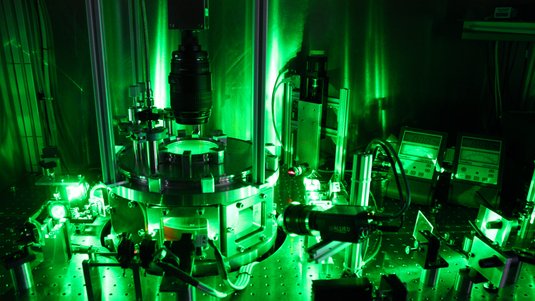Das Muster der Scherben

slowmotiongli/iStock
Fällt ein Glas zu Boden, zersplittert es in unzählige Teile unterschiedlicher Größe. Die Anzahl und Formen der Scherben lassen sich bisher nicht vorhersagen. Doch nun bringt ein Physiker etwas Ordnung ins Chaos der Splitter. In der Fachzeitschrift „Physical Review Letters“ stellt er ein mathematisches Modell vor, das die scheinbar zufällige Verteilung der Bruchstückgrößen erklären kann. Damit lassen sich künftig womöglich auch Umweltbelastungen durch mehr oder weniger feines Mikroplastik genauer einschätzen oder Recyclingprozesse in der Industrie optimieren.
Als entscheidende Größe für sein Modell wählte Emmanuel Villermaux von der Universität Aix-Marseille die Entropie, ein Maß für die Unordnung. Bei jedem Zersplittern soll sie möglichst groß sein, so sein Ansatz. Mathematisch lässt sich das durch eine exponentielle Verteilung der Bruchstückgrößen beschreiben: So entstehen bei jedem Zerbrechen wenige große und sehr viele kleine Bruchstücke. Zusätzlich floss die Form des ursprünglichen Objekts als Exponent in das mathematische Modell ein. Sie wurde grob als eindimensional – sprich: stabförmig, zweidimensional – eine flache Scheibe – bis zu dreidimensional – ein würfel- oder kugelförmiges Objekt – beschrieben.
Einfluss von Dimensionalität und Aufprallgeschwindigkeit
Ein Teller beispielsweise lässt sich näherungsweise als zweidimensionales Objekt betrachten. Ein Vergleich mit tatsächlich auftretenden Splittern ergibt im Modell einen Exponenten von etwa 2,4. Der Wert ist etwas größer als zwei, da ein Teller keine ideale Fläche ist, sondern sich auch etwas in die dritte Dimension ausdehnt. Entsprechend ergab sich für einen zersplitternden Glasstab ein Exponent von 1,3 – denn auch dieser ist etwas in den Raum ausgedehnt. Villermaux überprüfte die Vorhersagen seines Modells auch mit dem Zerbröseln eines Zuckerwürfels. Auch hier gelang es, die Größenverteilung der Bruchstücke zu beschreiben.
Insgesamt stimmen die Werte des Modells verblüffend gut mit den Splittergrößen aus Experimenten überein – von zerbrechenden Glasstäben und -platten über explodierende Keramik bis zur Tropfenbildung von Flüssigkeiten im Sturm. Das gilt auch, wenn ein Teller schneller zu Boden fällt. Insgesamt entstehen dann mehr Bruchstücke. Sie sind zwar allesamt kleiner, die Verteilung zwischen den kleineren und größeren Scherben im Scherbenhaufen bleibt jedoch identisch.
Das neue Modell kann aber nicht nur die Bruchstücke zerspringenden Geschirrs beschreiben. Es kann auch besser erklären, in wie viele Teile welcher Größen sich Plastikmüll in der Natur zersetzt. In der Industrie könnte sich so bei Mahl-, Schneide- und Recyclingprozessen planen lassen, ob möglichst kleine Partikel oder große Stücke entstehen sollen.
Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/nachrichten/2025/modelle-das-muster-der-scherben/