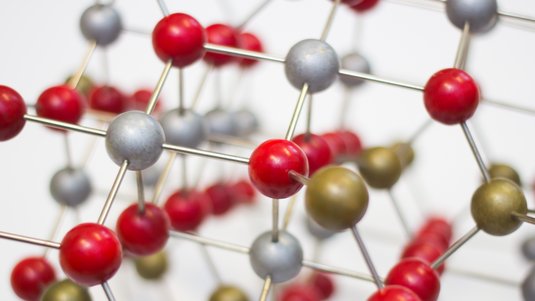Winzlinge mit riesiger Oberfläche
Roland Wengenmayr

Nur einen bis fünf Nanometer (Milliardstel Meter) groß sind die Edelmetallpartikel, welche die Arbeitsgruppe von Helmut Bönnemann am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim herstellt. Die „Teilchenzwerge“ haben jedoch eine vergleichsweise riesige Oberfläche. Nähme man ein Gramm von ihnen und rollte die gesamte Oberfläche aller Partikel flach aus, dann würde ihre Oberfläche 250 bis 300 Quadratmeter bedecken. Diese und andere wichtige Eigenschaften müssen die Partikel mitbringen, damit aus ihnen leistungsfähige und robuste Katalysatoren für Brennstoffzellen produziert werden können.
Katalysatoren sind Materialien, die chemische Reaktionen beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen. Viele chemische Reaktionen werden durch eine hohe Energiebarriere behindert, welche die Reaktionspartner wie eine Mauer trennt. Ein Katalysator erniedrigt diese Barriere gezielt an bestimmten Stellen, wodurch die chemischen Reaktionen in die gewünschte Richtung ablaufen können. Zudem haben Katalysatoren noch den Vorteil, dass sie während der Reaktion weder chemisch verändert noch schnell verbraucht werden.
Auch die Brennstoffzelle braucht Katalysatoren, damit die „kalte Verbrennung“ von Wasserstoffgas oder anderen Brennstoffen mit Sauerstoff funktionieren kann. Als Katalysator eignen sich Edelmetallpartikel, mit denen die porösen Elektroden beschichtet werden. An der Kathode verwendet man zu diesem Zweck üblicherweise fein verteiltes Platin. Für die Anode eignet sich Platin ebenfalls, allerdings nur dann, wenn reiner Wasserstoff als Brennstoff eingesetzt wird. Weitere Forschungen könnten jedoch zeigen, dass kohlenwasserstoffhaltige, flüssige Brennstoffe wie beispielsweise Methanol oder synthetisches Benzin („Synfuel“) praxistauglicher als Wasserstoff sind. Werden diese Brennstoffe in einer Niedertemperatur-Brennstoffzelle chemisch umgesetzt, entstehen geringe Mengen von Kohlenmonoxid und andere Nebenprodukte, die Anodenkatalysatoren aus reinem Platin „vergiften“. Eine der möglichen Strategien, eine Niedertemperatur- Brennstoffzelle gegen die Kohlenmonoxid-Vergiftung zu „immunisieren“, besteht in der Verbesserung der Katalysatoren durch Zugabe eines zweiten Metalls oder sogar von mehreren Metallen.
Die Wissenschaftler vom „Department für Heterogene Katalyse und Funktionale Feststoffe“ des Mülheimer Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung bemühen sich seit 1993 um die Entwicklung hochwirksamer Kathoden- und Anodenkatalysatoren, welche die Katalysatorgifte tolerieren. Die Basis dieser Katalysatoren sind Nanopartikel, die aus einem oder mehreren Edelmetallen bestehen. Die Nanopartikel haben eine Oberfläche, die im Vergleich zu ihrem winzigen Durchmesser sehr groß ist. Diese Eigenschaft ist wesentlich für einen optimalen Katalysator, weil die chemische Reaktion nur an der Oberfläche dieser Partikel stattfindet. Bestehen die Nanopartikel aus zwei Metallen, so können die Forscher die Eigenschaften der Partikel bei der Herstellung so steuern, dass sie Katalysatorgifte besser vertragen.
Ein wichtiges Instrument der Chemie ist die Synthese, also die Herstellung einer Substanz durch Umsetzung in chemischen Reaktionen. Nanopartikel aus Platin und anderen Metallatomen – Fachleute nennen sie „nanostrukturierte Platinkolloide“ - werden nach folgendem Rezept synthetisiert: Man löst im Reagenzglas Platinsalze in einer Flüssigkeit und versetzt sie mit so genannten Reduktionsmitteln. Vereinfacht ausgedrückt, brechen die Reduktionsmittel die Platinsalz- Moleküle auf und erzeugen auf diese Weise freie Platinatome; dazu werden hydridische oder metallorganische Reduktionsmittel in flüssiger Phase verwendet.
Bei Zimmertemperatur reifen die Keime
Die freien Platinatome finden sich zu sehr kleinen „Keimen“ zusammen, die nur aus wenigen Atomen bestehen. Diese Keime reifen bei Raumtemperatur zu nanometergroßen Partikeln. In dem Beispiel ändert sich innerhalb von 36 Stunden die Farbe der Lösung vom Hellgelb des Platinsalzes stufenweise bis zum dunklen Krapprot der fertig ausgereiften Nanopartikel. Die Nanopartikel werden dann aus der Flüssigkeit isoliert und liegen schließlich als Pulver vor, das zum Katalysator verarbeitet werden kann.
Wie sind diese Nanopartikel aufgebaut? Die Mülheimer Forscher können mit ihrer Synthesemethode beispielsweise Metallpartikel mit einem Durchmesser von etwa 2,5 Nanometern herstellen. Bei Metallpartikeln dieser Größe liegen etwa 60 Prozent der Atome an der Oberfläche. Diese Oberflächenatome sind die Zentren, an denen die chemische Reaktion katalytisch aktiviert wird. Bei einem Verhältnis von 60 Prozent Oberflächenatomen zu nur 40 Prozent Volumenatomen, die im Inneren der Nanopartikel eingeschlossen sind, funktionieren Katalysatoren optimal.
Reine Platin-Katalysatoren vertragen weder Kohlenmonoxid noch andere Katalysatorgifte. Legierungen aus Platin und Ruthenium hingegen machen die Anode unempfindlicher gegen die Vergiftung, denn die Kohlenmonoxid-Moleküle können sich schlechter auf deren Oberfläche festsetzen. Aber auch die Eigenschaften heutiger Platin-Ruthenmium (Pt-Ru)-Katalysatoren erfüllen die Erwartungen noch nicht. Deshalb untersuchen die Mülheimer Forscher neue Kombinationen verschiedener Metalle. Die Experten können die Synthese so fein steuern, dass beispielsweise aus zwei Metallen aufgebaute Nanopartikel mit genau definierter Struktur entstehen. Dabei kann wahlweise eingestellt werden, ob beide Metallatomsorten in diesen „Bimetall-Partikeln“ gleichmäßig im Inneren verteilt sind, oder ob sich eine der beiden Atomsorten an der Oberfläche anreichert. So lassen sich die Eigenschaften von Brennstoffzellen-Katalysatoren variieren und die Ergebnisse in der Praxis testen.
Nach der Synthese der metallischen Nanopartikel wird der fertige Katalysator hergestellt und getestet. Abb. 1 zeigt schematisch, wie ein vorfabriziertes Nanopartikel, das aus Platin und Ruthenium besteht, auf das Trägermaterial des Katalysators aufgebracht wird. Die Forscher haben den gesamten Ablauf – nach dem englischen Wort „Precursor“ (“Vorläufer“) - „Precursor-Konzept“ getauft. Damit ist gemeint, dass die Mülheimer Synthesegruppe stabilisierte Nanopartikel als Vorläufer des späteren Brennstoffzellen-Katalysators herstellt. Die Precursor-Partikel werden auf dem Kohlenstoffträger deponiert, dann isolieren die Forscher den fertigen Katalysator als schwarzes Pulver. Gemeinsam mit Kollegen aus den physikalisch-analytischen Gruppen des Mülheimer Max-Planck-Instituts erforschen sie zuerst die Größe, Zusammensetzung und innere Struktur der Nanopartikel. Im zweiten Schritt wird dann ein internationales Netzwerk aus Arbeitsgruppen an mehreren renommierten Forschungsinstituten aktiv. Sie untersuchen die Nanopartikel sowohl in freier Form als auch auf einem Träger mit hochspezialisierten Geräten – Chemiker nennen dies die „Charakterisierung“ eines Stoffes. Schließlich werden die Partikel auf die Membran aufgebracht und die fertigen Katalysatorsysteme geprüft.
Wenn das frisch hergestellte Precursor-Pulver im Reaktionsgefäß vorliegt, kann noch niemand sagen, wie groß die Nanopartikel sind und welche Eigenschaften sie haben. Das Team um Bernd Tesche befasst sich unter anderem mit dieser Frage. Mit herkömmlichen Mikroskopen lassen sich derart kleine Partikel nicht „anschauen“. Solche Mikroskope arbeiten mit sichtbarem Licht, dessen Wellenlängen zwischen 380 bis 780 Nanometern liegen. Diese Wellenlängen sind mehrere hundertmal größer als die ein bis fünf Nanometer großen Partikel und damit viel zu grob. Ein Nanopartikel würde Lichtwellen so wenig beeinflussen wie ein einzelnes Sandkorn eine Welle im Meer.
Nanopartikel unter dem Mikroskop
Um die Nanopartikel „ansehen“ zu können, setzen die Wissenschaftler zwei miteinander kombinierte Geräte ein. Das Transmissions-Elektronenmikroskop schickt Elektronen, die eine viel kürzere Wellenlänge haben als Licht, durch die Probe mit den Nanopartikeln hindurch und produziert daraus ein Bild. Das zweite Gerät arbeitet mit speziellen Röntgenstrahlen und identifiziert die Metallatome, aus denen die Nanopartikel aufgebaut sind. Aus diesen Untersuchungen erhalten die Mülheimer Forscher bereits Informationen über die Größe der Partikel und ihre innere Struktur. Die Struktur ist besonders interessant, wenn sie aus mehreren Sorten von Metallatomen bestehen.
In der wissenschaftlichen Grundlagenforschung ist längst Alltag, was sich allmählich auch im Gesundheitswesen durchsetzt. Weil die hochentwickelten Geräte sehr teuer sind und Spezialwissen zu ihrer Bedienung nötig ist, arbeiten Institute mit verschiedenen wissenschaftlichen Ausrichtungen und technischen Ausstattungen zusammen. Das geschieht auch beim zweiten Schritt des Mülheimer Precursor-Konzepts. Um die Struktur der Nanopartikel – und damit ihre Eigenschaften – noch genauer kennen zu lernen, wird ein Synchrotron eingesetzt; das ist ein Teilchenbeschleuniger, in dem elektrisch geladene Teilchen, zum Beispiel Elektronen, in einer kreisförmigen Bahn fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können. Dabei strahlen sie Röntgenlicht mit besonderen Eigenschaften ab, Synchrotron-Strahlung.
Die Synchrotron-Strahlung verschafft den Wissenschaftlern einen tiefen Einblick in die genaue Zusammensetzung der Nanopartikel. Damit lässt sich feststellen, ob aus mehreren Metallen bestehende Nanopartikel einen Kern und eine Schale aus unterschiedlichen Metallatomsorten haben, beispielsweise aus Platin und Ruthenium. Um ihre Proben an einem Synchrotron untersuchen zu lassen, arbeitet die Mülheimer Synthesegruppe mit Josef Hormes zusammen. Dessen Arbeitsgruppen an der Louisiana State University in Baton Rouge (USA) und an der Universität Bonn sind darauf spezialisiert, die Struktur aus mehreren Metallen zusammengesetzter Nanopartikel mit Synchrotron-Strahlung zu analysieren. Entscheidend für die katalytische Funktion der Nanopartikel sind die elektrochemischen Eigenschaften ihrer Oberflächen. Hier übernimmt das Team von Jürgen Behm an der Universität Ulm die Leitung des Projekts und führt den oberflächenchemischen Bereich der Forschungsarbeit weiter.
Nachdem die Precursor-Partikel eingehend auf ihre Größe, ihre innere Struktur und ihre chemischen Eigenschaften untersucht worden sind, werden sie auf dem Trägermaterial deponiert. Danach wird das Material erwärmt und dabei abwechselnd einem Wasserstoff- und einem Sauerstoffstrom ausgesetzt. So entsteht der fertige Katalysator, der nun geprüft werden kann.
Den Praxistest übernehmen die Brennstoffzellen-Spezialisten von Jürgen Garche am „Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung“ in Ulm. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert diese Zusammenarbeit, ebenso wie die Kooperation mit den Gruppen von Hormes und Behm. Nun zeigt sich, wie sich die neuen Katalysatormaterialien während des praktischen Betriebs in der Brennstoffzelle verhalten: Macht ihre Struktur sie weniger anfällig gegen Kohlenmonoxidvergiftung? Welche Leistung bringt der neue Katalysator unter Betriebsbedingungen? Bleibt das Material langfristig stabil? Das sind einige der Fragen, die sich bei den Tests klären lassen. Die Ergebnisse fließen dann in die Arbeit an der Weiterentwicklung der Nanopartikel ein.
Methanol aus kleinen Patronen
Auch in Los Alamos (USA) werden die Mülheimer Katalysatoren erprobt. Dort beschäftigt sich die Arbeitsgruppe von Piotr Zelenay mit Brennstoffzellen für ein vollkommen neues Einsatzgebiet, das sich erst in den vergangenen Jahren entwickelt hat. In Zukunft sollen sehr kleine Brennstoffzellen die Akkus in elektrischen Geräten wie Laptops oder Handys ersetzen und deren Betriebsdauer erheblich verlängern. Zelenays Gruppe baut Miniatur-Brennstoffzellen, die Methanol aus kleinen Patronen direkt chemisch umsetzen sollen. Die Mülheimer Katalysatoren sollen diese Brennstoffzellen gegen die Vergiftung durch die Methanol-„Verbrennung“ und ihre Nebenprodukte widerstandsfähig machen.
Jeder Katalysatortyp zeigt ein eigenes, sehr komplexes Verhalten und damit Stärken und Schwächen, die bis heute kaum theoretisch vorhergesagt werden können. Um einen optimalen Katalysator für eine bestimmte Anwendung zu finden, muss deshalb mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen experimentiert werden. Eine Stärke der Mülheimer Max-Planck-Wissenschaftler ist die innovative Herstellung von Nanopartikel-Precursorn unter Kombination von zwei oder sogar drei verschiedenen Metallen, wie sie bisher nicht für Brennstoffzellen- Katalysatoren zur Verfügung standen. Um auch Nanopartikel mit bisher unüblichen Metall-Kombinationen in ihre Untersuchungen einbeziehen zu können, arbeiten die Mülheimer mit Nenad Markovic an der California State University in Berkely (USA) zusammen. Er untersucht diese winzigen Partikel mit verschiedenen Methoden in Bezug auf das katalytische Verhalten ihrer Oberflächen.
Es ist noch nicht entschieden, ob „legierte“ Nanopartikel aus mehreren Metallatomsorten, die gleichmäßig im Partikel verteilt sind, in den Brennstoffzellen-Katalysatoren wirklich optimal wirken. Deshalb beschäftigt sich die Mülheimer Synthesegruppe auch mit Systemen, in denen die beiden Metallsorten in Schichten übereinander gelagert sind. An der Grenzfläche stehen beide Atomsorten in engem Kontakt. Vor allem von den besonderen Wechselwirkungen der beiden Atomsorten an der Grenzfläche werden für Brennstoffzellen-Katalysatoren eine weitere Verbesserung der katalytischen Aktivität, Vergiftungsresistenz und Langzeitstabilität erwartet.
Die Entwicklung optimaler Brennstoffzellen- Katalysatoren ist ein gutes Beispiel dafür, dass komplexe Technologien nur erfolgreich entwickelt werden können, wenn Forscher über die Grenzen der Disziplinen und Institute hinweg eng zusammenarbeiten. Erst wenn erkenntnisorientierte Grundlagenforscher wie die Mülheimer Chemiker und anwendungsorientierte Forscher und Ingenieure ihre Ergebnisse intensiv austauschen und ihr spezifisches Können einbringen, hat die Brennstoffzelle eine Chance, bald eine alltagstaugliche Technik zu werden.
Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/brennstoffzellen/metallpartikel/